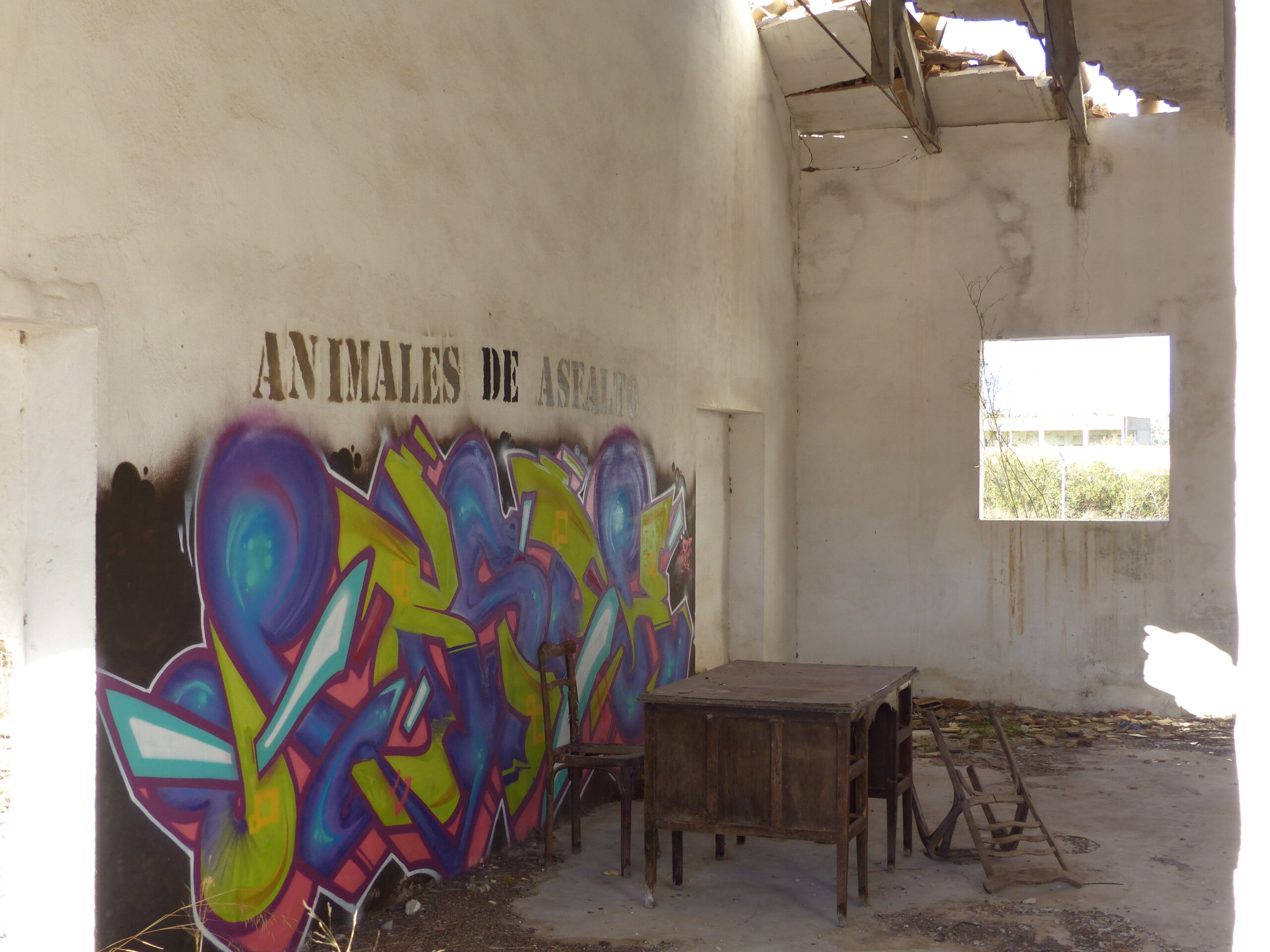Wut ist eine schwierige Emotion für viele Menschen. Wenn uns etwas richtig aufregt, scheint sie uns regelrecht zu beherrschen, unser Einfühlungsvermögen in andere ist auf stumm geschaltet, vielleicht meldet sich noch die Stimme der Vernunft aus dem Off, aber meist sind wir außerstande innezuhalten und hinterher, naja… sammeln wir die Scherben ein.
Aus biologischer Sicht erfüllt unsere Wut genau das, wofür die Evolution sie vorgesehen hat. Die Funktion unseres präfrontalen Kortex rückt in den Hintergrund. Unser Gehirn bereitet uns auf Kampf und Verteidigung vor: Im Angesicht des Säbelzahntigers wägen wir nicht ab und fühlen uns auch nicht in unser Gegenüber ein.
Aber auch ohne Säbelzahntiger im Vorgarten erfüllt Wut wichtige Funktionen:
Sie ist ein Aktivator, der uns hilft, Energie und Durchsetzungskraft aufzubringen, um für uns selbst einzustehen und uns abzugrenzen.
Sie dient als Kommunikationsmittel, indem sie anderen signalisiert, dass eine Grenze überschritten wurde.
Und sie ist ein Signal. Sie weist uns darauf hin, dass etwas, das uns wichtig ist – zum Beispiel unsere Werte oder Bedürfnisse – nicht erfüllt ist.
Die Verdrängung von Schmerz
Es gibt diese Situationen und Themen, über die wir uns immer wieder aufregen und es kann uns vorkommen, als würde unsere Wut hier keine Funktion erfüllen und nirgendwohin führen. Wir ärgern uns dann über uns selbst, weil wir keinen konstruktiven Umgang mit dem Thema finden, sondern irgendwie feststecken in unserer Wut.
Wie oben beschrieben hat Wut auch eine Signalfunktion. Sie ist ein Wegweiser zu unseren Werten und Bedürfnissen. Manchmal reagieren wir auf diese Signale aber nicht und dann hängen wir fest. Ich versuche es an folgendem Beispiel zu erläutern:
Vielen von uns fällt es leichter, sich über den Nachbarn, der seinen Hund an der Kette hält, aufzuregen, als die Trauer zu fühlen, die der Anblick dieses armen Wesens in uns hervorruft oder die Angst, die aufkommt, wenn wir uns bewusst machen, dass wir etwas dagegen tun könnten oder die Ohnmacht, wenn wir eben dies schon erfolglos versucht haben.
Dafür gibt es verschiedene Gründe:
Wenn es um Situationen geht, in denen wir uns ohnmächtig fühlen, kann Wut eine Schutzstrategie gegen das Gefühl der Ohnmacht sein, weil sie uns vor dem Gefühl passiven Leidens bewahrt, das wir damit verbinden. Sie ist aktivierend und gibt uns das Gefühl handlungsfähig zu sein, selbst wenn wir in dem Moment nichts an der Situation ändern.
Wenn wir unsere Wut nicht körperlich oder sprachlich sehr extrem ausleben, ist sie der gesellschaftskonformere Ausdruck von Trauer. Wir würden wahrscheinlich auf Unverständnis stoßen, wenn wir bei allem, was gegen unsere Werte verstößt, anfangen würden zu weinen.
Unsere Bedürfnisse und Gefühle zu zeigen, scheint uns verletzlicher zu machen und in manchen Kontexten ist das tatsächlich nicht ratsam.
Manchmal liegt es aber auch in unseren Kindheitserfahrungen begründet, dass wir uns nicht verletzlich zeigen und hat mit der heutigen Realität gar nichts zu tun. Das ist dann keine bewusste Entscheidung.
Dies kann so weit gehen, dass wir nur noch schwer Zugang finden zu den Gefühlen unter unserer Wut. Wenn wir als Kind die Erfahrung gemacht haben, dass das Äußern unseres Schmerzes über unerfüllte Bedürfnisse wirkungslos geblieben ist oder unsere Situation sogar verschlimmert hat, haben wir gelernt Schmerz nicht nur als etwas Unangenehmes, sondern auch als etwas Unnützes anzusehen. Man könnte sagen, es ergab schlicht keinen Sinn für uns, mit dem Schmerz in Kontakt zu bleiben.
Das kann nicht nur in der Interaktion mit den Eltern verursacht worden sein, sondern auch durch mangelnde Präsenz von Erwachsenen in der Konfliktbegleitung in Geschwisterbeziehungen bzw. in Schule und Kindergarten.
Die Wut auflösen
Wenn wir diese Wut auflösen möchten, müssen wir eine Ebene tiefer forschen. Worauf weist sie uns hin? Welche Gefühle liegen unter unserer Wut? Welche unserer Werte und Bedürfnisse sind nicht erfüllt?
Das mag weh tun und sich weniger kraftvoll anfühlen, aber es birgt auch eine Schönheit, denn es sind die Dinge, die uns besonders wichtig sind, die uns wütend machen, wenn sie nicht gut laufen. Und es kann sich gut anfühlen innerlich wieder weicher zu werden und mitfühlend die eigenen Bedürfnisse und Werte anzuerkennen.
In diesem Prozess werden wir klarer darin, was wir brauchen und können dadurch Konflikte konstruktiver gestalten. Wut und Schmerz werden zur Brücke für Wachstum und Verbundenheit.
Der nächste Schritt wäre uns in den anderen hineinzufühlen, zu erkennen, dass auch er aus seinen eigenen Bedürfnissen heraus handelt und uns bewusst zu entscheiden, auf welcher Ebene wir in die Kommunikation treten möchten. Aber dazu vielleicht ein anderes Mal mehr.
Wenn du über neue Beiträge informiert werden möchtest, dann abonniere gerne meinen Newsletter.